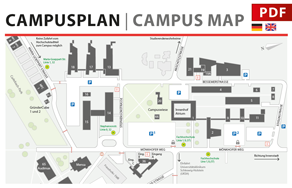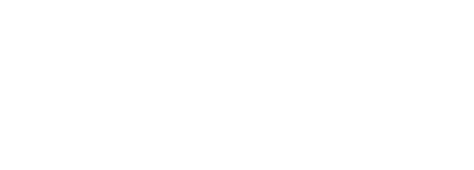Am 14. Juni 2018 stellten zwei Teams von Bau-Studierenden ihre Semesterprojekte zum Thema Bahnübergang Ratzeburger Allee im Rahmen der Vortragsreihe Architektur und Bauingenieurwesen im Fachbereich Bauwesen vor.
Dieses Projekt, von den verantwortlichen Bau-Professoren Jens Emig und Achim Laleik als erstes übergreifendes Pilotprojekt gesehen, ist die erste Pilotmaßnahme, bei der Studierende aus allen drei Masterstudiengängen des Fachbereichs Bauwesen, den Masterstudiengängen Architektur, Bauingenieurwesen und Städtebau/ Ortsplanung, zusammengearbeitet haben.
Professor Emig: „Wir haben mit diesem Thema endlich einmal ein Modul geschaffen, bei dem unsere Masterstudierende nicht anderthalb Jahre nebeneinanderher studieren, sondern wo diese drei Fachrichtungen zusammen einmal ein Problem, ein Projekt teamfähig erarbeiten. In sehr, sehr kurzer Zeit, in drei Wochen um genau zu sein, lag die Bearbeitungszeit für das Projekt, die nicht im Kämmerchen oder im Labor stattgefunden hat, sondern mit Exkursionen und Ortsbegehungen ein sehr intensives praxisbezogenes Arbeiten beinhaltete. In jedem Team waren Studierende aus allen drei Studiengängen vertreten, um nicht nur die Sichtweise einer Baudisziplin zu beleuchten.“
Inhaltlich drehte es sich um den Städtebaulichen Entwurf „Bahnübergang Ratzeburger Allee“. Dieser ist seit langem ein Problem. Ehmig formulierte in seiner Begrüßung die Situation um den Bahnübergang und skizzierte die Problemstellung, die sich für die umliegende Nachbarschaft, besonders dem Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH), mit dem Bahnübergang über die Ratzeburger Allee ergibt.
Dr. Christian Elsner, Geschäftsführender Direktor des UKSH sieht das Hauptproblem in der Notfallversorgung für die Stadt Lübeck, die das UKSH sicherzustellen hat. In erster Linie sind es die Wartezeiten für die Rettungs- und Notfallfahrzeuge, die wie alle anderen auch, bei geschlossener Schranke im Stau stehen. Mehrmals täglich queren Züge die alte Bundesstraße 207, der südlichen Hauptzufahrt nach Lübeck-Mitte, mit der Folge langer Rückstaus, unangemessener Wartezeiten für Fahrradfahrer und Fußgänger, gefährlicher Einmündungen und Kreuzungen aus den anliegenden Gewerbe- und Einkaufszentren im Staubereich sowie hoher Lärmbelästigung für Anwohner*innen.
Mit großem Interesse verfolgten die rund 60 Gäste, Studierende, Anwohner*innen, Vertretungen des UKSH und der Deutschen Bahn AG die Neugestaltungsvorschläge zu dem Problembereich Bahnübergang Ratzenburger Allee mit unmittelbaren Kreuzungsbereichen auf der Allee.
In der Vorbereitung der Entwürfe konnte die Deutschen Bahn mit viel Input, besonders aus dem Bereich des Gleisbaus, die Studierendenteams unterstützen. „Es sind technische Prämissen, die bei der Bahninfrastruktur anders zu sehen sind als beim Straßenverkehr. So kann bspw. ein Gleis nicht unendlich geneigt werden wie eine Straße. Oder wegen der Elektrifizierung müssen bestimmte Werte der lichten Höhe bei einer Unterführung eingehalten werden. Diese und weitere Informationen haben wir den Studierenden mit auf den Weg gegeben. Sie haben es wirklich sehr gut in ihren Entwürfen verarbeitet“, sagte einer der Bahn-Vertreter.
Die Teams präsentierten zwei Varianten, beide losgelöst von den ökonomischen Machbarkeiten. Keines der Teams hatte sich für eine Straßen-Überführung der Ratzeburger Allee über den Bahnübergang in Form einer Brücke entschieden. Insbesondere die zu berücksichtigen Wertevorgaben der Bahn sowie Lärmschutzbestimmungen waren bei diesen Überlegungen ausschlaggebend.
In der ersten Variante beließ das Team die Bahntrasse auf dem bisherigen Niveau und unterführte den Autoverkehr in Troglage unter die Gleise. Der Fahrrad- und Fußgängerverkehr wird mittels einer schlangenartigen Brücke, dem Radschnellweg, vom PKW-Verkehr entkoppelt. Die Brücke touchiert die umliegenden Gewerbegebiete mal links- mal rechtsseitig. Über Aufzüge sind die Gewerbeflächen, die ebenfalls in der Infrastruktur/ Zufahrt umgestaltet werden, zu beiden Seiten der Ratzeburger Allee barrierefrei zu erreichen.
Auch das zweite Team hat sich für eine Verkehrsunterführung entschieden. In dieser Variante werden alle Verkehrsteilnehmenden, Auto-, Fußgänger- wie auch der Fahrradverkehr gemeinsam unter die Gleise unterführt. Dazu werden die Gleise moderat angehoben, um die Unterführung nicht zu tief absenken zu müssen. Auch dieses Team hat die umliegende Verkehrs- und Gewerbegebietsinfrastruktur berücksichtigt und somit weniger gefährdende Kreuzungsbereiche geschaffen.
Im Anschluss an die Präsentation nahmen die Gäste die Gelegenheit wahr und diskutierten die Varianten intensiv. Dabei sprach Dr. Elsner vom UKSH über die Motivation, diese Initiative der Studierenden zu unterstützen. Er führte an, dass neben dem UKSH, als einzige Institution, die die Akutversorgung in der Hansestadt Lübeck sicherzustellen hat und das sich zu einem der größten Zentren der Patientenversorgung entwickelt, täglich rund 8.000 Menschen ihre Arbeitsplätze am UKSH, an der Universität und der Technischen Hochschule Lübeck erreichen müssen. Dazu muss das Problem beseitigt werden.
Unter der bereits laufenden Maßnahme Initiative Gleisfrei des UKSH wurde ein Online-Voting zu den zwei Varianten der Studierenden eingerichtet. Im Ergebnis gab es ein Kopf an Kopf-Rennen mit kleinen Vorteilen für den Radschnellweg als Brücke. Elsner sprach damit die dringende Beseitigung des Problems an, bedankte sich bei den Studierenden für die praxisorientierten Lösungsvorschläge und mahnte ein zeitnahes Angehen des Problems an.
Über das Zusammenwirken der drei Masterstudiengänge und das Ergebnis im Rahmen dieses ersten Pilotprojektes aus Studierendensicht sagte ein Teammitglied: „Es hat auf jeden Fall gut funktioniert. Am Anfang war es etwas schwierig, weil wir uns erst einmal auf einander einstimmen mussten. Wir mussten lernen, wie andere die Probleme sehen und dieses mit zu berücksichtigen. Weil wir diese Form der Zusammenarbeit noch nicht hatten, mussten wir uns in die Denke und in die Gedankenwelt der anderen Disziplinen reinfuchsen und die Gedankengängen nachvollziehen. Es beginnt ja schon bei den Software-Programmen mit denen wir arbeiten; so sind die der Architektur anders als die des Bauingenieurwesens. Jede/r beherrscht die Software anders.
Aber schlussendlich und im Nachhinein hat es viel gebracht. Als Architektin habe ich nicht viel Verständnis von Verkehrsströmen, wie sie die Ingenieurswelt betrachten muss. Aber ich habe viel gelernt. Und es hat Spaß gemacht, im Team mit Studierenden aus unterschiedlichen Disziplinen zu arbeiten. Darüber hinaus hat es gezeigt, dass wir nicht früh genug beginnen können, miteinander zusammenzuarbeiten, wie es im wirklichen Leben und in der Arbeitsrealität erfolgt.“